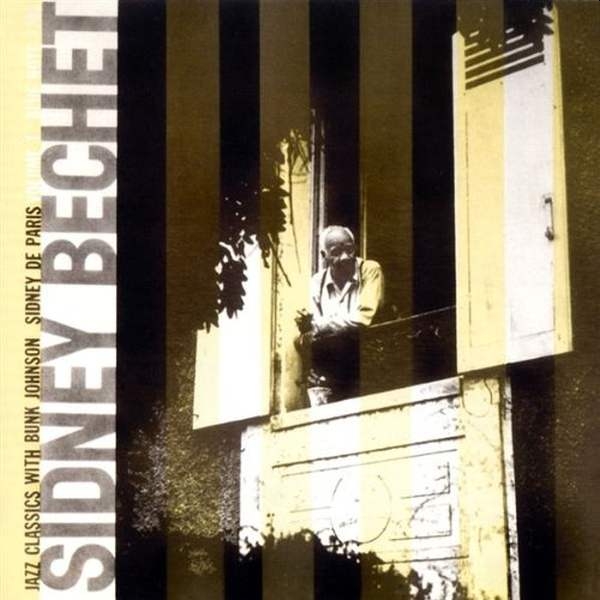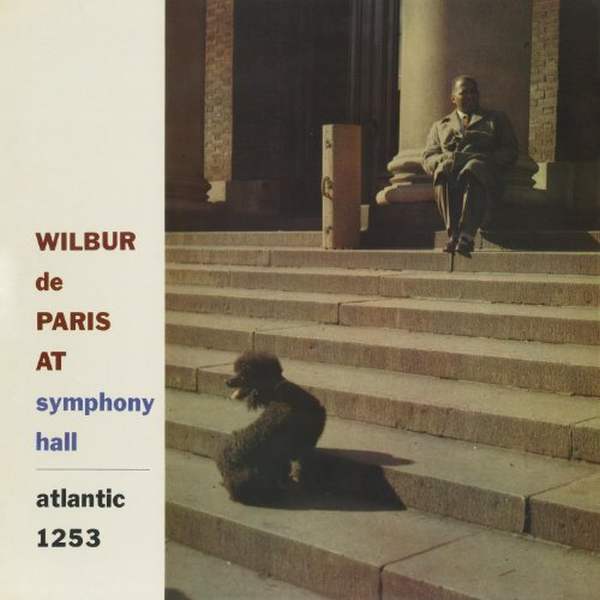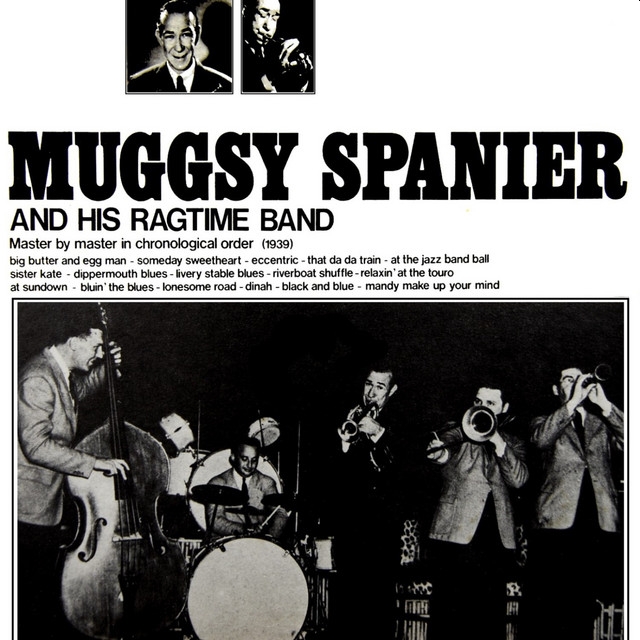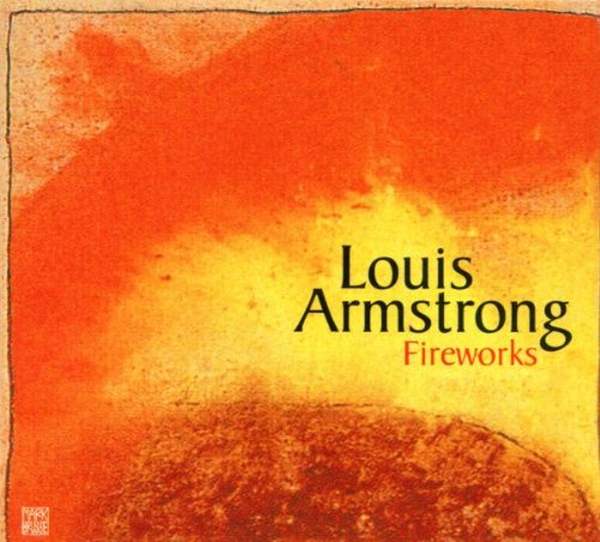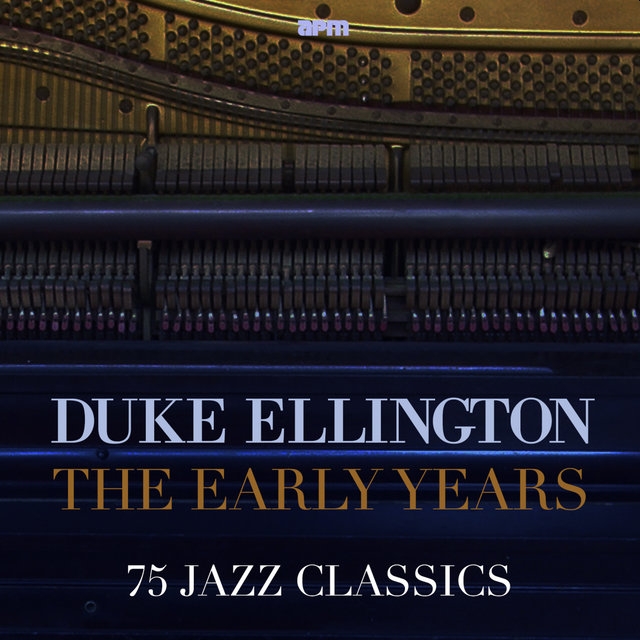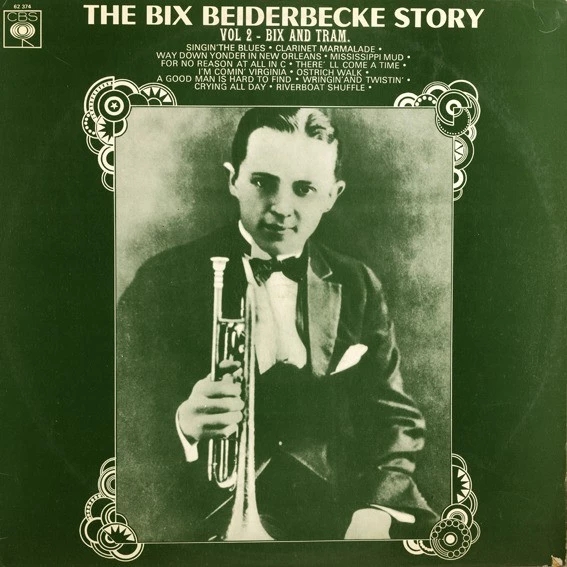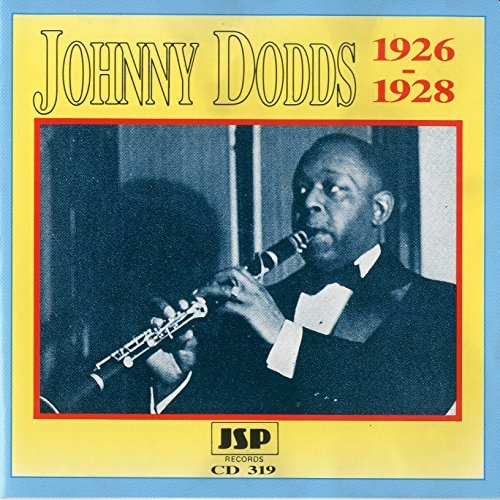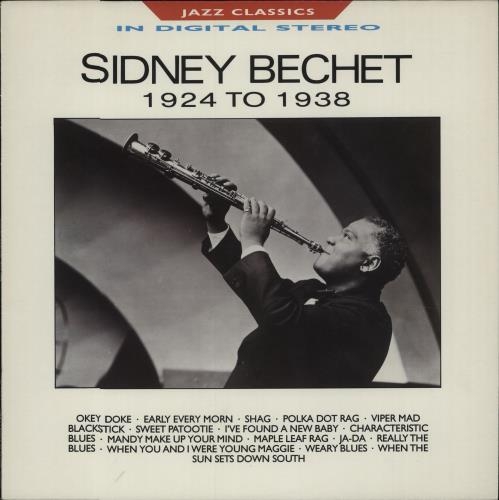Die Geschichtschreibung einer improvisierten Musik ist auf die Dokumentation musikalischer Ereignisse angewiesen, will sie sich nicht in Legenden erschöpfen. Die Jazzgeschichtsschreibung ist ohne das Medium der Schallplatte nicht denkbar. Die Legenden um den Trompeter Buddy Bolden (1877-1931) beispielsweise beleuchten die Sozialgeschichte des frühen Jazz und die Stellung eines schwarzen Musikers zu Beginn dieses Jahrhunderts. Seine Musik selbst allerdings ist für den Historiker verloren, da er in eine Nervenanstalt eingewiesen wurde, bevor Schallplattenaufnahmen allgemein üblich waren (Marquis 1978). Das historische Wissen um die Marschmusik, die Salon- und Ragtimeorchester aus dem New Orleans zum Anfang dieses Jahrhunderts nährt sich einzig aus Notenmaterial und niedergeschriebenen Arrangements sowie Klangbeispielen aus späteren Jahren.
Sidney Bechet - Jazz Classics Vol. 1Anspieltipp: SummertimeBechet, Sidney (ss); Lewis, Meade Lux (p); Bunn, Teddy (g); Williams, John (b); Catlett, Sid (dr)Aufnahmedatum: 08-06-1939 [...Wikipedia] |
Wilbur de Paris - At Symphony HallAnspieltipp: Juba DanceParis, Wilbur de (tb); Paris, Sidney de (co); Simeon, Omer (cl); White, Sonny (p); Blair, Lee (bj); Moten, Bennie (b); Kirk, Wilbert (dr, harm)Aufnahmedatum: 26-10-1956 [...Wikipedia] |
Muggsy Spanier - Ragtime BandAnspieltipp: Big Butter And Egg ManSpanier, Muggsy (co); Brunis, George (tb); Cless, Rod (cl); McKinstry, Ray (ts); Zack, George (p); Casey, Bob (g); Pattison, Pat (b); Greenberg, Marty (dr)Aufnahmedatum: 07-07-1939 [...Wikipedia] |
Louis Armstrong - FireworksAnspieltipp: West End BluesLouis Armstrong & His Hot Five: Armstrong, Louis (tp, voc); Robinson, Fred (tb); Strong, Jimmy (ts, cl); Hines, Earl (p); Carr, Mancy (bj); Singleton, Zutty (dr)Aufnahmedatum: 1928-06-28 [...Wikipedia] |
Duke Ellington - Early YearsAnspieltipp: Creole Love CallDuke Ellington & His Orchestra: Miley, Bubber; Metcald, Louis (tp); Nanton, Sam (tb); Jackson, Rudolf (cl, ts, bs); Hardwick, Otto (ss, as, bs); Carney, Harry (cl, as, bs); Ellington , Duke (p); Guy, Fred (bj); Braud, Wellman (b); Greer, Sonny (dr)Aufnahmedatum: 26-10-1927 [...Wikipedia] |
Bix Beiderbecke - The Bix Beiderbecke StoryAnspieltipp: Singin' The BluesFrankie Trumbauer & His Orchestra: Trumbauer, Frankie (c-melody); Beiderbecke, Bix (co); Rank, Bill (tb); Dorsey, Jimmy (cl, as); Riskin, Itzy (p); Lang, Eddie (bj, g); Morehouse, Chauncey (dr)Aufnahmedatum: 04-02-1927 [...Wikipedia] |
Johnny Dodds - 1926-1928Anspieltipp: Gate MouthNew Orleans Wanderers: Mitchell, George (co); Ory, Kid (tb); Dodds, Johnny (cl); Clark, Joe (as); Armstrong, Lil (p); St. Cyr, Johnny (bj)Aufnahmedatum: 13-07-1926 [...Wikipedia] |
Tommy Ladnier/Sidney Bechet - 1924 To 1938Anspieltipp: Really The BluesTommy Ladnier & Orchestra: Ladnier, Tommy (tp); Bechet, Sidney (cl, ss); Mezzrow, Mezz (cl, ts); Jackson, Cliff (p); Bunn, Teddy (g); James, Elmer (b); Johnson, Manzie (dr)Aufnahmedatum: 28-11-1938 |